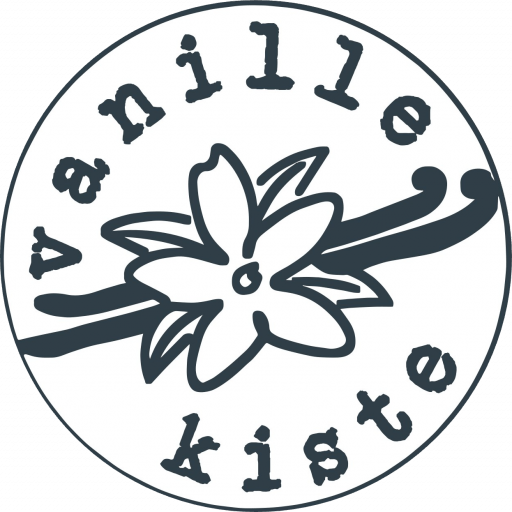Es gibt wohl niemanden, der ihren Geschmack nicht kennt und liebt, und aus vielen Süßspeisen ist sie gar nicht wegzudenken. Ganz klar: Die Rede ist von unserem Lieblingsgewürz, der Vanille. Doch so selbstverständlich wie heute war ihr Genuss nicht immer. Erfahre hier alles über den langen Weg, der die Gewürzvanille aus ihrer kleinen Schote bis hinein direkt in unsere Herzen geführt hat.
Früher Beginn bei den Azteken
Lange bevor die kleine Vanilleschote sich auf die Reise nach Europa machte, war sie den Azteken im heutigen Mexiko bereits unter dem Namen „Cacixanatl“ ein Begriff. Die Azteken selbst jedoch kamen mit der Gewürzvanille erst in Berührung, nachdem ihr Herrscher Itzcoàtl das Volk der Totonaken unterwarf. Diese waren über lange Zeiten nämlich die einzigen, die in der Lage waren, die Vanillepflanze anzubauen. Es rankten sich Legenden um die Pflanze, die besagten, dass sie dem Leib einer verstorbenen Prinzessin entstammte. So kam es dann auch, dass die Totonaken einen Teil ihres Tributes an ihren neuen Herrscher in Vanille entrichten mussten. Die Azteken waren als Entdecker des Kakaos, in ihren Worten noch Xocolatl, hin und weg von dem für sie bis dahin unbekannten Gewürz. Über den späteren Aztekenherrscher Montezuma II. hat sagte man nach, dass er täglich um die 50 Portionen eines Vanille-Kakao-Gemischs genoss.
Von den Azteken über die Spanier nach Europa
Bei den Azteken lernte der berühmt-berüchtigte Spanier Hernán Cortez die Gewürzvanille kennen und brachte diese, neben anderen Exponaten wie Kakao und einigen exotischen Tierarten, in sein Heimatland. Dort angekommen dauerte es jedoch noch einige Zeit, bis die Spanier mit dem neuartigen Gewürz warm wurden. Lange Zeit betrachtete man Vanille eher als abrundendes Gewürz für Schokolade. Das ist natürlich auch nicht ganz unpassend, rundet die Gewürzvanille doch perfekt den bitteren Geschmack des Bohnenerzeugnisses ab. Dennoch konnte sich Spaniens High-Society schließlich für die südamerikanische Vanilleschote erwärmen, jedoch blieb das Gewürz den reicheren Gesellschaftsschichten vorbehalten. Spanien besaß das Monopol auf die Vanilleschote und hütete es derartig streng, dass eine illegale Ausfuhr mit dem Tode bestraft wurde. Dies konnte jedoch nicht verhindern, dass die Gewürzvanille ihren Weg nach Großbritannien fand, wo der findige Apotheker Hugh Morgan eine vanillehaltige Süßspeise kreierte, von der selbst Queen Elizabeth I. nicht genug bekommen konnte.
Aus den darauffolgenden 1780er-Jahren ist bekannt, dass Thomas Jefferson, zu seiner Zeit als Außenminister in Frankreich, das Vanilleeis von den Franzosen kennenlernte. Diese würzten schon seit einiger Zeit ihre Eiscreme so, dass Jefferson derartig verzückt war, dass er das Rezept niederschrieb und mit in seine Heimat nahm, wo es noch heute in der Library of Congress zu finden ist.
Nachdem Mexiko im Jahre 1810 seine Unabhängigkeit erlangte, gelangten Ableger der Vanilleschote, beziehungsweise der Vanille-Orchidee in die Botanischen Gärten Frankreichs und den Niederlanden. Hier tat sich jedoch ein Problem auf: Man war nicht in der Lage, Samen der empfindlichen Orchidee zu gewinnen. Erst im Jahre 1836 sollte der belgische Landsmann Charles Morren entdecken, dass der Grund hierfür ein simpler war: Die Bienen, die in der Herkunftsregion der Vanille dafür zuständig sind, die Orchidee zu bestäuben, sind in den hiesigen Regionen schlicht nicht heimisch. Morren gelang es 1837 ein Verfahren zur künstlichen Befruchtung der Pflanzen zu entwickeln, dieses erwies sich jedoch als sehr aufwendig.
Bereits im Jahre 1819 begannen die Niederländer mit ihren Versuchen, die Vanille-Orchidee auf ihren Kolonien in Java zu kultivieren, 1822 brachten die Franzosen sie auf die im indischen Ozean gelegene Insel La Réunion, die bis 1848 noch unter dem Namen île Bourbon bekannt war. Von dieser sollte die heute bekannte Bourbon-Vanille auch ihren Namen erhalten.
Dieser Ort war es auch, an dem der junge Sklave Edmund Albius ein simpleres, jedoch nicht unbedingt weniger arbeitsintensives, manuelles Verfahren zur Bestäubung der Vanille-Orchidee finden sollte, welches letztendlich bis heute noch angewendet wird. Für dieses Verfahren sind eine Menge Erfahrung und Kenntnis der Pflanze vonnöten. Normalerweise wächst die komplette Vanille-Pflanze lianenartig im zick-zack an einem Baumstamm herauf. Dort wachsen die Orchidee-Blüten und öffnen sich für ein Zeitfenster von 24 Stunden. In dieser Periode muss die Blüte der Vanille bestäubt werden. In der Natur geschieht dies über die sogenannte Melipona-Biene, oder durch Kolibris. Geschieht dies nicht, stirbt die Blüte ab und fällt zu Boden. Die Arbeiter müssen also den genauen Zeitpunkt abpassen können, indem sich eine Blüte öffnet. Umso bemerkenswerter also die Tatsache, dass ein geübter Plantagenarbeiter so 1.000 bis 1.500 Pflanzen am Tag bestäuben kann.
Madagaskar als führende Region im Vanilleanbau
Heutzutage hat sich der Anbauschwerpunkt weg von Mexiko, mehr in Richtung der Insel Réunion und vor allem Madagaskars verschoben. So werden auf Madagaskar bis zu 2.000 Tonnen Gewürzvanilleschotten geerntet. Das sind bis zu 80 % der weltweit gehandelten Vanille. Wetterbedingt kommt es hier jedoch zu teils starken Schwankungen, sieht sich die Insel jährlich mit häufig Unwettern konfrontiert. Dennoch steht Madagaskar an erster Stelle beim Vanilleanbau. Dabei ist die Ernte ähnlich aufwendig wie die Bestäubung der Pflanzen. Die Früchte müssen einer sogenannten Schwarzbräunung unterzogen werden. Das heißt, dass die Vanilleschote zuerst Heißwasser-, oder Wasserdampfbehandelt werden muss. Anschließend wird sie wochenlang in luftdichten Kisten in der Sonne getrocknet. Dabei nehmen die Vanilleschoten ihre bekannte, schwarzbraune Form an und entwickeln ihr einzigartiges Aroma, welches weltweit geschätzt und geliebt wird.